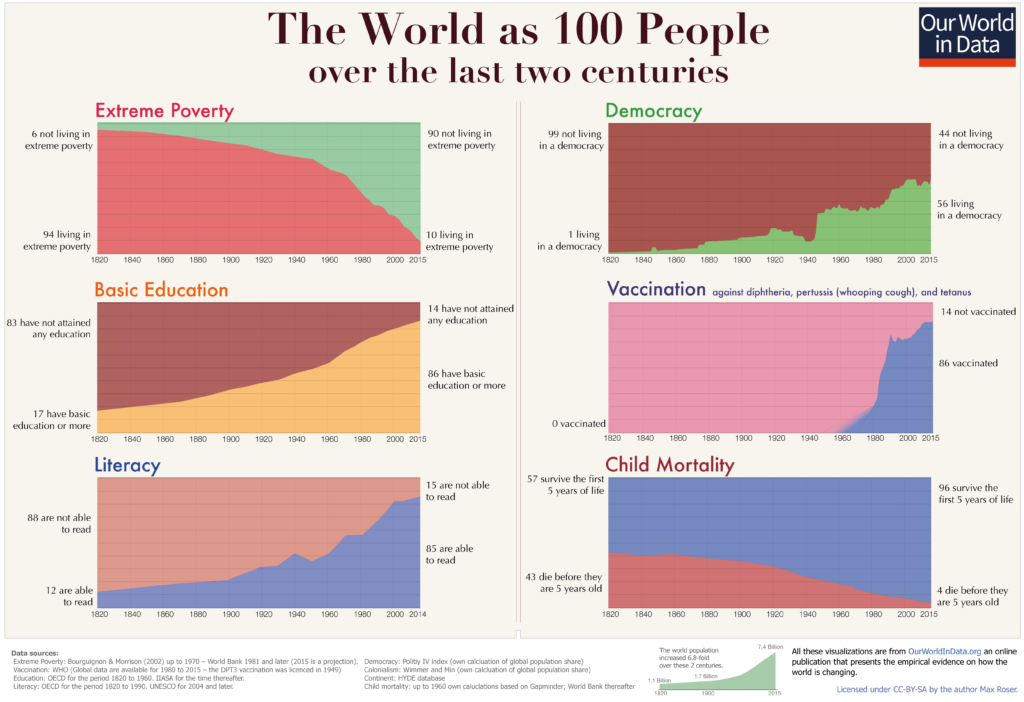Zeit fasziniert mich. Wer sich näher mit dem Phänomen der Zeit beschäftigt, merkt, dass wir eigentlich nur sehr wenig davon verstehen. Was ist Zeit? Welche Elemente machen unser Zeitgefühl aus? Und weshalb ist unser landläufiges Verständnis von Zeit so anders als dasjenige der Physik?
Zeit ist die Uhr des Lebens
3 Milliarden Mal schlägt unser Herz im Durschnitt; anschliessend sind wir tot. Die Zahl ist zwar riesig, doch stimmt sie uns zugleich nachdenklich. Zeit wird gemeinhin als “kostbar” empfunden. Und weil sie für jeden Menschen gleichermassen gilt, kommt ihr anders als materiellem Reichtum eine egalisierende Wirkung zu. So verstanden ist Zeit die grosse philosophische (resp. theologische) Nivellierung; ein Naturgesetz also, nach dem sich jeder zu richten hat.
Drei Konzepte der Zeit möchte ich im Folgenden anschauen:
Erstens: Zeit in der alltäglichen Wahrnehmung
Wir haben ein klares Verständnis davon, dass Zeit eine Aneinanderreihung von Momenten ist, der wir hilflos ausgesetzt sind. Diese spezifische Art der Wahrnehmung der Zeit gibt uns das Gefühl der Vergangenheit und der Zukunft, und dass es scheinbar nur eine Richtung der Zeit gibt, nämlich von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft (“Pfeil der Zeit”).
“Eine Sandburg, die einmal zerstört ist, baut sich nicht von selbst wieder auf.”
Eine Sandburg, die einmal zerstört ist, baut sich nicht von selbst wieder auf. Auf jeden Fall hat dies niemand bisher beobachten können. Physiker führen die wahrgenommene Richtung der Zeit auf die Zunahme der Entropie (Mass der Unordnung) im Universum zurück. Einem Cappuccino gleich, der zu Beginn eine klare Trennung von Kaffee und Milchschaum kennt, jedoch allmählich zu diffundieren beginnt, wird das Universum mit der Zeit, ausgehend vom Big Bang, “unordentlicher”. Diese Annahme wird getroffen, weil es mehr Wege gibt und damit wahrscheinlicher ist, dass sich Unordentlichkeit einstellt als dass sich die Bausteine dieser Welt spontan zu etwas “Ordentlichem” formen, wie etwa zu Galaxien, Planeten, Menschen, Hühnereiern oder eben Sandburgen.
Entsprechend folgen wir auch intuitiv einer chronologischen Abfolge, wenn wir von Erlebnissen erzählen (Ursache-Wirkung bzw. Kausalität). Beispielsweise stecken wir uns zuerst mit einer Grippe im Büro an (oder verlieben uns), die in der Folge zu einer Erkrankung führt (zur Beziehung), welche wir schliesslich mit Medikamenten und Bettruhe zu Hause erfolgreich behandeln (Trennung…).
Der tägliche Sprachgebrauch ist ein Indikator dafür, wie bedeutsam Zeit zur abstrakten Ordnung unserer Erlebnisse und zu deren Kommunikation mit anderen Menschen ist: Beispielsweise können wir uns problemlos um 20:00 Uhr verabreden; wir sprechen von “vorher” und “nachher” und verstehen ganz genau, was unser Gegenüber damit meint; und schliesslich ist uns Menschen der Nordhalbkugel klar, was es bedeutet, wenn die Blumen blühen (Frühling), die Hitze einkehrt (Sommer), die Blätter der Bäume sich rot färben (Herbst) oder der erste Schnee fällt (Winter).
Zeit ist im Alltag allgegenwärtig, als ob wir über einen Ort, einen Menschen oder unsere Gefühle sprechen würden. Ohne temporale Begrifflichkeiten als sprachliches Hilfsmittel wäre ein Grossteil unserer Kommunikation un- oder zumindest missverständlich. Wir haben uns darum auf einen sprachlichen Standard geeinigt, welcher dem Faktor Zeit einen bedeutenden semantischen Platz einräumt.
Zweitens: Zeit als psychologisches Phänomen
Umgekehrt begreifen wir Zeit auf eine Weise, die nicht zwingend mit der objektiven Realität der Zeit übereinstimmen muss. So stellen wir fest, dass wir Zeit anders wahrgenommen haben, als wir noch Kinder waren. Erinnern wir uns doch einmal zurück an unseren ersten Urlaub am Meer – wie unendlich lang uns dieser doch vorkam! Dieses rein intuitive Gefühl ist tatsächlich real, wie Psychologen nachweisen konnten. Demnach nehmen Kinder grundsätzlich den Zeitverlauf langsamer wahr als ältere Menschen. Tatsache ist, dass Kinder alle Erfahrungen zum ersten Mal machen müssen; wenn wir hingegen älter werden, besitzen wir mehr Routine und viele Dinge kommen uns wie “déjà-vus” vor. Dies kann dazu führen, dass uns der Zeitablauf schneller vorkommt.
Andererseits nehmen wir die Zeit als langsamer verstreichend wahr, wenn wir gelangweilt in einem Flugzeug zu sitzen haben, bevor wir endlich am Strand liegen können. Die “Zeit totschlagen” kann damit rasch zur Hauptaufgabe bei Langeweile werden. Beim Lesen einer interessanten Lektüre oder in einem Moment der Anspannung, wie etwa an einer Prüfung, vergeht hingegen die Zeit “wie im Flug”.
Paradoxerweise erscheinen uns retrospektiv allerdings oft gerade die spannenden Zeiten als sehr langwierige Perioden, wohingegen die ereignisarmen Phasen nur schlecht in unserer Erinnerung zu haften vermögen.
Unser Gehirn ist auch die Quelle, die uns ein extrem starkes subjektives Gegenwartsgefühl gibt, wobei der Gegenwartsmoment immer nur eine rein logische Annahme ist und nicht der objektiven Realität entsprechen kann, weist doch jeder Reiz eine minimale Übertragungsverzögerung von wenigen Milli- oder sogar bloss Mikrosekunden auf. Wir leben also (biologisch streng genommen) immer in der Vergangenheit!
Wir leben also (biologisch streng genommen) immer in der Vergangenheit!
Drittens: Zeit als messbare Grösse
In der Physik ist Zeit schliesslich eine messbare Grösse. Das Messen der Zeit findet mittels Uhren statt. Wesensmerkmal von Uhren ist dabei eine Periodizität in ihrer Funktionsweise. So misst der Herzschlag etwa unsere Lebenszeit, die Sonne (in Relation zur Erde) die Tageslänge, der Mond (in Relation zur Erde) den Monat und der Umlauf der Erde um die Sonne das Jahr. Menschen nutzten diese Naturerscheinungen bereits sehr früh, um Uhren zu bauen (z.B. Sonnen-, Sand- und Wasseruhren) und Kalender zu konstruieren (z.B. Stonehenge [umstritten], Islamischer Mondkalender, Gregorianischer Sonnenkalender). Mechanische Uhren kamen erst viel später als Zeitmesser hinzu.
Diese Uhren sind allerdings relativ ungenau, da sie den unterschiedlichsten Kräften und Veränderungen ausgesetzt sind, wie etwa Schwankungen der Lufttemperatur oder des Luftdrucks. Demgegenüber sind Atomuhren weniger störungsanfällig, da sie auf den Schwingungen der zerfallenden Atome beruhen. Dieser Kleinstbereich ist deutlich weniger “noisy”.
Bei Isaac Newton waren Zeit und Raum noch feste Konstanten. Albert Einstein räumte aber mit der Newtonschen Theorie auf, indem er aufzeigte, dass die Raumzeit eine eigene Dimension darstellt, die abhängig vom Betrachter lediglich relativ gilt. Grundsätzlich bedeutet dies, dass die Zeit nicht für alle Menschen dieselbe, sondern abhängig von der Geschwindigkeit des untersuchten Systems und die ihn umgebende Gravitation ist. Dies führt zur von Einstein berechneten Zeitdilatation. Damit stellt die Physik die Zeit als universelle Konstante in Frage. Entsprechend sprechen Physiker heute von einer bloss subjektiven Auffassung davon, was Zeit darstellt, oder sogar von einer Illusion!
Zeit und menschliches Bewusstsein werden damit auf eine ähnliche Ebene gestellt. Über beide Phänomene wissen wir heute nur wenig.
“Zeit und menschliches Bewusstsein werden damit auf eine ähnliche Ebene gestellt. Über beide Phänomene wissen wir heute nur wenig.”
“Primitives” Verständnis von Zeit genügt oft…
Zeit ist eine ungemein facettenreiche Idee. Für den Nichtphysiker genügt allerdings das Konzept der Zeit, wie wir sie im Alltag wahrnehmen. Diese Auffassung ist sozusagen real genug und lässt uns genügend effizient und fehlerlos miteinander kommunizieren. Auf jeden Fall hindert uns unser “primitives” Zeitverständnis nicht daran, die Komplexität eines Cappuccinos wertschätzen zu können!